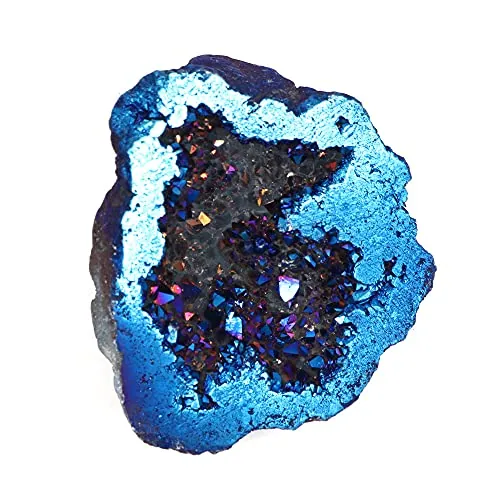| FARBE: | grün |
|---|---|
| Familie: | Quarz |
| Aufladen: | Sonne |
| Chakren: | Herzchakra |
| Länder: | Tschechische Republik, Österreich, Deutschland |
| Sternzeichen: | keine Zuordnung |
| Spirituell: | vermittelt eine grenzenlose Weite, fördert die Hellsichtigkeit, lässt immense geistige Dimensionen erleben |
| Seelisch: | stärkt Einfühlungsvermögen |
| Mental: | bringt spontane, unkonventionelle Ideen und Problemlösungen |
| Körperlich: | unterstützt die Heilungsprozesse im Körper, er macht die Ursache der Erkrankungen bewusst |
| Anwendung: | auflegen auf die Stirn , tragen am Körper |

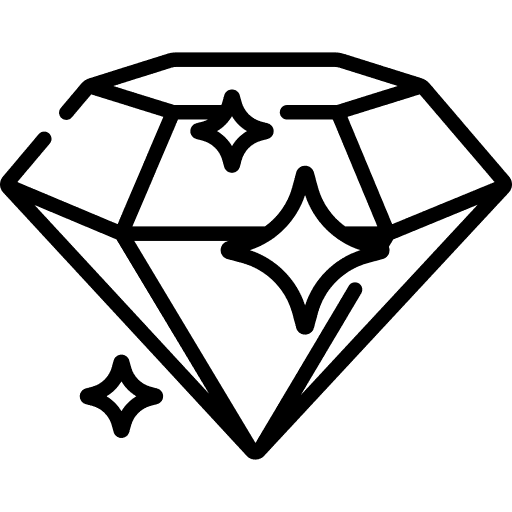 Schmuckstücke
Schmuckstücke
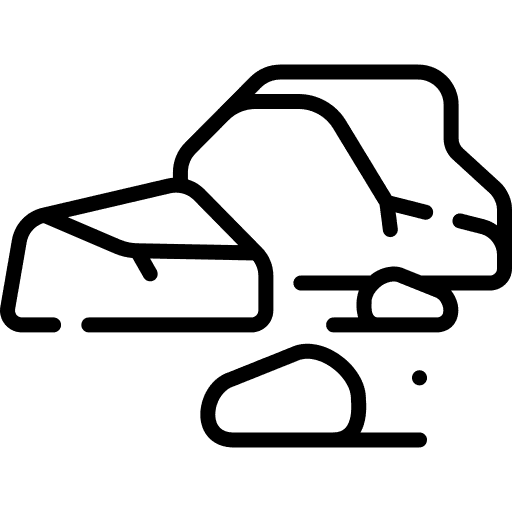 Natürliche Steine
Natürliche Steine
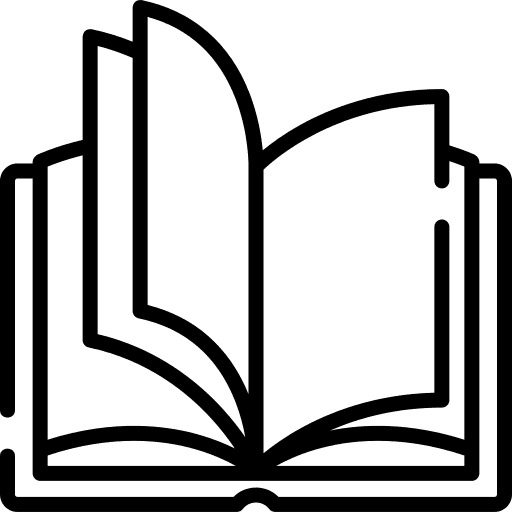 Bücher & DVD
Bücher & DVD