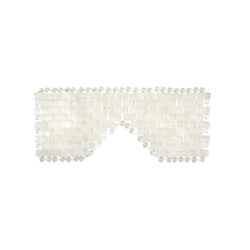„Gesteinsbildner“ der Dolomiten
Obwohl Dolomit als Gestein keine Seltenheit ist, wurde das Mitglied der Carbonate erst im Jahre 1791 von dem französischen Mineralogen Déodat de Dolomieu bei einer Alpenreise entdeckt. Da sich die vermeintlichen „Kalksteine“ bei einer Prüfung nicht wie typischer Kalk verhielten, erfolgte Anfang des 19. Jahrhunderts schließlich eine genauere Analyse.
Dolomit – ein Calcium-Magnesium-Carbonat
Die Entdeckung des Spurenelements Magnesiums im Jahre 1808, führte dazu, dass Dolomit (nach Dolomieu benannt) endlich bestimmt werden konnte. Deshalb ist die Bezeichnung der „Südtiroler Dolomiten“, die aus dem gesteinsbildenden Dolomit bestehen, eine recht junge Namensgebung ohne Tradition.
Synonyme für Dolomit
Da man den heute genannten „Dolomit“ traditionell zu den Kalkgesteinen und Mineralen (Calcit) rechnete, gibt es eine Vielzahl an Synonymen aus der Bergmannssprache, die auf diese vermeintliche Zugehörigkeit verweisen. Bitter- und Braunkalk, sowie Rauch- und Raukalk sind Beispiele, ebenso wie Rauten-, Rhomben-, Kalktalkspat, Perl- und Bitterspat. Ein grobkristalliner Dolomit hatte den Namen „Urkalk“.
Weitere Synonyme sind „Gurhofit“ für feinkörnigen, „Zuckerdolomit“ weißen, feinkörnigen und „Lucullan“ für schwarzen Dolomit. „Tharandit“ ist eisenhaltig und „Mangandolomit“ enthält dementsprechend Mangan. Doch die Liste der Synonyme und Handelsnamen ist hier noch lange nicht erschöpft. Greinerit, Rudolphit, Risorit, Magnesiocalcit, Eosit, Rauch- und Rauwacke sind außerdem gebräuchliche Bezeichnungen für Dolomit.
Wie entsteht Dolomit?
Das gesteinsbildende Mineral Dolomit verbindet sich zu monomineralischen Gesteinsmassen, die Dolomitstein oder ebenfalls einfach nur Dolomit genannt werden. Die beiden Kalkmineralien Calcit und Aragonit sind nahe mit dem Dolomit verwandt und bilden deshalb die Calcit-Dolomit-Aragonit-Familie, die wiederum zur Mineralklasse der Carbonate gehört. Ein Dolomitstein muss zu mindestens 90% aus dem Mineral Dolomit bestehen, ansonsten handelt es sich um einen „dolomitischen Kalkstein“.
Dolomit entsteht eher selten primär und bildet sich dann hydrothermal auf Mineral- und Erzgängen. Meistens ist Dolomit jedoch sekundär durch Umwandlung von schon bestehender Kalkgesteinen entstanden. Bei Dolomit wurde während seiner sekundären Entstehung etwa 50% des Calciums durch Magnesium ersetzt, sodass sich auch die typischen Eigenschaften des reinen Calcium-Carbonats verändern können. Dieser Austausch geschieht, wenn magnesiumhaltige Lösungen auf meistens maritim entstandene Kalkgesteine einwirken. Dabei kann die sogenannte „Dolomitisierung“ sowohl während der Bildung von Kalkgesteinen, aber auch danach geschehen.
Frühdiagenetische Dolomitisierung
Hat der Dolomitisierungsprozess schon während der Kalksteinbildung (frühdiagenetisch) stattgefunden, zeigen sich die typischen Merkmale der Kalkstein-Schichtung und eventuelle fossile Versteinerungen auch beim Dolomit. Der im Handel weitverbreitete rostrot-weiße, gebänderte Dolomit-Marmor oder der beigefarbene „Ivoryit„, der auch noch deutlich sichtbare einzelne Schichten zeigt, sind so entstanden.
Spätdiagenetische Dolomitisierung
Bei einer späteren Dolomitisierung (spätdiagenetisch) außerhalb des Meeres werden die Schichten, Gefügemerkmale und Versteinerungen im bestehenden, festen Kalkstein durch magnesiumhaltige Lösungen unklarer und schließlich aufgelöst. Dies erschwert oft die Altersbestimmung des Gesteins. Spätdiagenetisch bilden sich massigere, teils grobkörniger wirkende Aggregate, wie beispielsweise der weiße „Zuckerdolomit“.
Das „Dolomit-Problem“
Neuste Studien zeigen am Beispiel von Lagunen in Brasilien, dass die sekundäre Dolomitisierung von Kalkschlamm mit Fäulnis und Schwefelbakterien einhergeht. Besonders oft sind die Riffgesteine und ebenso kalkhaltige Korallenriffe in geschützten Lagunen von einer Umwandlung in Dolomit betroffen. Dabei lässt sich das eher instabile Mineral Aragonit der Korallen leicht dolomitisieren.
Erst im Jahre 2023 konnte wissenschaftlich geklärt werden, warum es bisher misslungen ist, Dolomitkristalle künstlich im Labor herzustellen. Demnach ist ein Wechsel von unter- und übersättigten Dolomit-Lösungen notwendig, damit Dolomitkristalle wachsen können. Erst wenn die Fehler im Kristallgitter der ursprünglichen Gesteine durch untersättigte Lösungen ausgemerzt wurden, kann die anschließende übersättigte Lösung für weitere Schichten an Kristallwachstum sorgen.
Weltweite Vorkommen des Dolomitsteins
Auch wenn Dolomit erst Anfang des 19. Jahrhundert als eigenständiges Mineral identifiziert werden konnte, so kommt es doch als Gestein häufig vor. Aufgrund seiner Entstehung ist eine sogenannte „Vergesellschaftung“ (Paragenese) mit Kalkstein üblich. Je nach Magnesium- und Dolomit-Gehalt spricht man von „Dolomitstein“ (über 90%) oder „dolomitischem Kalkstein“ (unter 90% Dolomit-Gehalt).
Dolomiten der Alpen
In Europa liegt die Gebirgsgruppe der „Bleichen Berge“ mit dem charakteristischen Namen „Dolomiten“ in den italienischen Südalpen. Aber nicht nur im Südalpin, sondern auch im Ostalpin (Österreich) der Ostalpen, sowie den Karpaten (Rumänien, Slowakei) und Apenninen gibt es große Vorkommen an Dolomitgestein.
„Hauptdolomiten“ der Apenninen
Die sogenannten „Hauptdolomiten“ befinden sich in den Apenninen, die den größten Teil des italienischen Stiefels durchziehen. Diese Dolomit-Schichten bestehen hauptsächlich aus reinem Dolomit und sind bis zu 2200 Metern mächtig. Sie stammen aus der geologischen Zeitspanne des Mesozoikums (Obertrias: spätes Karnium (Karn) und darauf folgendes Norium vor ca. 226 bis 208 Millionen Jahren) und haben sich im Bereich einer damaligen Lagune gebildet.
Rheinisches Schiefergebirge
Dolomit und dolomitische Kalksteine sind allerdings auch in der geologischen Zeitspanne des Paläozoikums (Devon vor ca. 419 bis 359 Mio. Jahren) entstanden. Hier hat sich dolomitisierter Riffkalk aus beispielsweise Korallen und Schwämmen gebildet. Beispielhafte Fundorte befinden sich im deutschen „Rheinischen Schiefergebirge“ (Sauerland bis Eifel), das geologisch auch eine Einheit mit den belgischen Ardennen bildet.
Trierer Bucht, Südharz und "Alb"
Älter als die „Hauptdolomiten“ aus dem Obertrias (vor ca. 235 – 201 Mio. Jahren) sind Dolomitbildungen aus dem Mitteltrias (vor ca. 247 – 235 Mio. Jahren) in Muschelkalk, beispielsweise in der Trierer Bucht. Allerdings gibt es auch noch ältere Dolomit-Vorkommen, wie das Gestein am Südharz-Rand aus dem Oberperm (vor ca. 260 – 252 Mio. Jahren) beweist.
Jünger sind Dolomite aus dem Oberjura, auch Malm oder Weißer Jura genannt, die vor ca. 163 – 145 Mio. Jahren entstanden sind. Dolomite aus dieser jüngeren geologischen Periode findet man auf der Schwäbischen und Fränkischen Alb.
Südafrika und Australien
Weitaus ältere Dolomitsteine stammen jedoch aus dem Norden Südafrikas. Der sogenannte „Malmani-Dolomit“ ist stolze 2,5 Milliarden Jahre alt. In Höhlen aus Dolomit lebten einst die ersten urzeitlichen Menschenaffen, die zu den „Vormenschen“ gerechnet werden.
Aus Australien stammt ebenfalls ein Dolomit des Präkambriums, das bis zur Entstehung unserer Erde vor 4,56 Milliarden Jahren zurückreicht. Dieses Dolomit-Vorkommen im Südosten Australiens ist bis zu 635 Millionen Jahre alt.
Weitere Vorkommen an Dolomit
Dolomit gibt es natürlich nicht nur in Deutschland, Österreich, England und Spanien, auch die Schweiz hat vor allem einen grobkörnigen „Zuckerdolomit“ mit attraktiven messingfarbenen Pyrit-Lagen zu bieten. Auch Amerika (USA und Brasilien) gehört zu den Hauptlieferanten.
Merkmale des Dolomit-Minerals
Dolomit kristallisiert im trigonalen Kristallsystem und bildet Rhomboeder-Kristalle mit gekrümmten Kristallflächen. Diese Dolomit-Kristalle zeigen einen durchsichtigen Glasglanz. Allerdings kommen die grobkörnigen Aggregate wesentlich häufiger vor und führen schließlich auch zu großflächigen, undurchsichtigen Gesteinsbildungen durch Dolomitisierung der verschiedenen Kalkstein-Schichten.
Härte und Spaltbarkeit
Dolomit ist als wasserfreies Carbonat etwas härter und spröder als Calcit, auch wenn die Textur und Struktur der beiden ähnlich ausfällt. Dabei sind Kalkstein-Kristalle feinkörniger als die gröberen Dolomit-Kristalle, die gerne mit Zuckerkristallen verglichen werden (Zuckerdolomit). Die Mohshärte des Dolomits liegt mit 3,5 bis 4 unterhalb der Glashärte (5), aber oberhalb von Calcit (3). Auch seine Dichte von 2,85 bis 2,95 ist höher als die des Calcits (2,7), der als „Spat“ eine hervorragende Spaltbarkeit besitzt. Auch Dolomit lässt sich vollkommen spalten, zeigt aber einen spröden Bruch. Frische Bruchstellen sind grau, die sich verwittert gelblich bis braungrau färben. So kann man Felsen aus Dolomit an der Erdoberfläche gut an ihrer splittrig, spröden Oberflächenbeschaffenheit erkennen. Sie sind nicht wie die weicheren Kalkgesteine durch Wind und Wetter rund gewaschen.
Dolomit ist außerdem weniger lösungsanfällig gegenüber schwachen Säuren, als Kalkstein. Deshalb verkarstet er weniger stark (Karsthöhlen) und bildet andere, kantigere Formen an Oberflächenkarsten.


 Schmuckstücke
Schmuckstücke
 Natürliche Steine
Natürliche Steine
 Bücher & DVD
Bücher & DVD