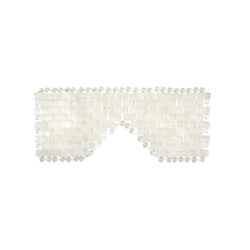Feldspat - ein wichtiger Rohstoff
Die große Gruppe der Feldspate ist vielfältig und hat in der Email-, Glas- und Keramikindustrie einen festen Platz. Durch natürliche Erosion bildet sich aus Feldspat die Bodenart "Ton", die weitgehend aus anorganischen Ton-Mineralen besteht. Ton ist einer der ältesten Rohstoffe, den die Menschheit früh zur Herstellung von Gefäßen und plastischen Kunstgegenständen nutzte. Für die Archäologie ist die Qualität und dekorative Gestaltung von ausgegrabenen Tonwaren und Tonscherben ein wichtiger Indikator für den jeweiligen kulturellen Stand einer frühen menschlichen Zivilisation. Beispielsweise stammen sogenannte "Bandkeramik-Funde" aus einer Zeit vor etwa 7500 Jahren, während die jüngeren Schnurkeramik-Funde weiter verbreitet waren und vor etwa 5000 Jahren entstanden.
Als Schmuckstein spielen heute einzelne Feldspat-Varietäten (z.B. Amazonit, Mondstein, Labradorit) nur eine untergeordnete Rolle, jedoch bilden einige Feldspate schöne Kristall-Stufen (z.B. Albit und Adular), die für die Sammelgemeinde höchst attraktiv sind.
Gemahlene, reine Feldspat-Minerale sind außerdem ein Grundstoff in der modernen Zahnmedizin. Als Ausgangsmaterial für Zahnersatz (z.B. Inlays) sind sie ideal, da sie ähnliche physikalische Eigenschaften besitzen wie unsere Zähne und chemisch gesehen unbedenklich sind.
Die drei Feldspat-Gruppen
Da die chemische Zusammensetzung dieser Gerüst-Silikate sehr unterschiedlich sein kann, besteht das größte Problem darin, sie voneinander zu unterscheiden. Ihre allgemeine chemische Formel lässt zu, dass einige Elemente durch andere ersetzt werden können. Bei einer sogenannten "Substitution" findet eine Austauschreaktion statt, wobei die unterschiedlichen "Austausch-Elemente" immer im gleichen Mengenverhältnis zu den restlichen Mineral-Bestandteilen bleiben. Die allgemeine Feldspat-Struktur verändert sich jedoch nicht.
Grundsätzlich teilt man die unterschiedlichen Feldspate in drei Gruppen ein. Diese sind Alkalifeldspate, Plagioklase und sogenannte tenäre Feldspate. Sie unterscheiden sich als Mischkristalle in ihrer chemischen Mineralien-Zusammensetzung.
Alkalifeldspat
Alkalifeldspate sind als Mischkristalle definiert, die Bestandteile von Albit und Kalifeldspat (Orthoklas, Mikroklin, Sanidin) aufweisen. Die entstehenden Mischkristalle "Anorthoklas" und "Sanidin" haben einen hohen Kalium- und Natrium-Anteil.
Plagioklas
Plagioklase (Kalknatronfeldspat) wiederum zeichnen sich durch einen hohen Calcium- und Natrium-Anteil aus und sind Mischkristalle aus Albit und Anorthit. Dabei unterscheiden sich die Feldspate je nach ihrem Anorthit-Anteil.
Ein Mischkristall mit weniger als 10 Prozent Anorthit trägt durch den mindestens 90 prozentigen Albit-Anteil die Bezeichnung "Albit".
Ein sogenannter "Oligoklas" liegt über 10 bis maximal 30 Prozent, während ein Plagioklas mit über 30 bis 50 Prozent Anorthit "Andesin" heißt.
Der bekannte, bunt schillernde "Labradorit" besitzt über 50 bis 70 Prozent Anorthit und "Bytownit" zwischen 70 und 90 Prozent.
Bei schließlich über 90 bis 100 prozentigem Anorthit-Anteil greift die Bezeichnung "Anorthit".
Tenärer Feldspat
"Tenäre Feldspate" bewegen sich innerhalb der Mischreihe Kalifeldspat-Albit-Anorthit.
So entsteht eine Vielzahl an anerkannten und nicht anerkannten Einzelminerale, Mischminerale und ihre Varietäten.
Woher stammt der Namen "Feldspat"?
Aus den Jahren um 1750 stammt wohl die heutige Bezeichnung "Feldspat", die sich aus der "vollkommenen Spaltbarkeit" des Gesteins entwickelt hat. Dabei war Jahrhunderte lang in der Bergmannssprache jedes Gestein ein "Spat", das sich besonders gut spalten ließ. Diese Eigenschaft lässt sich bei Feldspaten schon von den optisch gut erkennbaren Rissbildungen ableiten, die dazu führen, dass sich beim Abklopfen mit dem Hammer kleine Blättchen vom Gesteins- oder Mineralkörper ablösen.
"Feld-Erklärungsversuche"
Über die Herkunft der Zusatzbezeichnung "Feld" ist sich die Fachliteratur jedoch nicht ganz einig. Eine Möglichkeit verweist auf die Häufigkeit der Feldspate als Bestandteil in vielen Gesteinen. So könnte sich "Feld" auch von "Fels" ableiten. Die unterschiedlichen Feldspate sind schließlich die wichtigsten gesteinsbildenden Minerale der Erde, denn ihr Anteil in der Erdkruste macht etwa 60 Prozent aus.
Der Naturwissenschaftler und Schriftsteller Urban Brückmann stellte beispielsweise im Jahre 1783 die Vermutung auf, dass sich der Begriff "Feld" durch seine typische Erscheinungsform ableiten könnte. Denn Feldspat füllt nie ganze Gänge und bildet keine Gesteinsfelsen oder gar Gebirge, sondern tritt immer nur in Flecken oder "Feldern" in anderen Gesteinsarten (z.B. Granit) auf.
Eine weitere Theorie stammt vom französischen Mineralogen René-Just Haüy, der in seinem Buch aus dem Jahre 1804 den Fundort der Feldspat-Gesteine, nämlich das "Feld", als Namensgeber favorisiert. Da Feldspat dort durch Erosion mit der Zeit zerfällt und somit zu einem Bestandteil des vom Menschen bestellten Ackerfeldes wird, erscheint diese Vermutung plausibel. Denn traditionelle Bezeichnungen orientieren sich oft an den Eigenheiten und am Offensichtlichen.
Synonyme - allgemein und im Besonderen
Der Häufigkeit an Feldspat-Vorkommen ist es geschuldet, dass mit der Zeit sehr viele unterschiedliche Synonyme entstanden sind. Veraltet ist beispielsweise der Begriff "Mikrofelsit", der die Deutung "Fels" für "Feld" ermöglicht. Eine heute noch gültige Bezeichnung im Handel ist "Buntfeldspat", die ein Gemenge aus verschiedenen Feldspaten beschreibt. Dieser Buntfeldspat gehört zu den Heilsteinen der modernen Steinheilkunde.
Für die verschiedenen Varietäten der oben erwähnten Feldspate "Orthoklas" und "Plagioklas" existiert eine Vielzahl an eigenen Synonymen. "Adular" trägt beispielsweise, als eine Varietät des Kalifeldspates "Orthoklas", außerdem den Namen "Valencianit"... Spanien lässt grüßen.
Feldspat-Varietäten der Steinheilkunde
Der als Heilstein verwendete seltene trikline "Mikroklin" ist ein primär entstandener Kalium-Feldspat, der sich mit Bleigehalt zum häufiger vorkommenden, grünen "Amazonit" verwandelt. Beide sind bekannte Heilsteine, die ihr individuelles Wirkspektrum aufweisen.
"Labradorit" gehört zu den "Plagioklasen" und ist ein Mischkristall aus den Feldspaten "Albit" und "Anorthit" (Kalkfeldspat). Letzterer erfreut sich weiterer, eigener Synonyme, wie beispielsweise Biotin, Calciklas, Barsowit oder Linseit.
Bekannte Feldspat-Varietäten sind außerdem Mondsteine (Orthoklas) und das Mischmineral Sonnenstein, das eine Mischreihe aus Feldspat und Quarz bildet. Allerdings sind nicht alle Zwischenglieder einer Feldspat-Mischreihe offiziell als Mineral, bzw. Varietät anerkannt. Dazu gehört beispielhaft die oben erwähnte Albit-Anorthit-Reihe (Plagioklase) mit ihren Mitgliedern Labradorit und Sonnenstein (Aventurin-Feldspat).
Weitere Handelsnamen und Synonyme
Um die allgemeine "Feldspat-Verwirrung" für Unkundige noch zu steigern, sollen hier noch weitere Synonyme beispielhaft erwähnt werden:)
Andesin = Pseudoalbit, Anorthoklas = Parorthoklas = Soda-Mikroklin und Oligoklas = Peristerit = Rhombenfeldspate = Natronspodumen gehören ebenfalls zu den nicht anerkannten, eigenständigen Mischmineralen der Feldspat-Gruppe. Dagegen gilt monokliner Sanidin = Eisspat = Rhyakolith = Thyakolith offiziell als eine Modifikation von Orthoklas, die unter Hochtemperaturen entstanden ist.
Wie entsteht Feldspat?
Die chemische Zusammensetzung und die jeweilige Temperatur der ursprünglichen Gesteinsschmelze entscheiden darüber, welcher Feldspat-Typ im später magmatisch gebildeten Gestein entstehen konnte. Große Kristalle können dabei ausschließlich primär pegmatitisch oder auch hydrothermal, wenn heißes Wasser aus den Tiefen aufsteigt und Gesteine durchdringt, entstehen.
Magmatit - Siliciumdioxid und Temperatur
Bei verhältnismäßig niederen Temperaturen bildet sich in Magmen mit hohem Siliciumdioxid-Gehalt primär "Kalifeldspat". Während dieses Magma abkühlt und kristallisiert, entstehen die Gesteine Granit und Rhyolith mit Kalifeldspat-Gehalt.
Ist dagegen die Schmelze eher arm an Siliciumdioxid und die Temperatur vergleichsweise hoch, bilden sich "Plagioklase", die sich dann als Bestandteil in basischem Ergussgestein "Basalt" (Vulkanit) oder magmatischem Gestein "Gabbro" finden lassen. Der Plutonit "Gabbro" kristallisiert ebenso wie Granit tief in der Erdkruste. Da Gabbro langsamer abkühlt, können größere Kristalle wachsen, als bei schnell an der Erdoberfläche erstarrtem Basalt.
Während einer "Primären Bildung" entstehen beispielsweise die bekannten Heilsteine Amazonit, Mikroklin, Mondstein, Buntfeldspat, Orthoklas, Labradorit oder das Mineralgemisch Sonnenstein.
Feldspat-Staub in Sedimenten
Eine "Sekundäre Bildung" in Sedimentiten ist selten. Da Feldspat leicht an der Oberfläche verwittert, bleibt er oft nur als erodierte Substanz in Form von Staub erhalten. Feldspat-Staub spielt bei der Regenbildung eine entscheidende Rolle. Staubfeine Feldspat-Partikel sind sehr aktive Aerosole, die sich in der Atmosphäre verteilen und dort als Kondensationskerne zur Wassertropfen-Bildung führen. Wasserreiche Wolken bringen schließlich den notwendigen Regen. Wie dieses Wettergeschehen im einzelnen funktioniert, ist allerdings noch nicht hinreichend erklärbar. Weitere Forschungen sollen in der Zukunft klären, warum manche Wolken Regen bringen und andere nicht.
Durch Erosion entsteht aus Feldspat außerdem die oben erwähnte Bodenart "Ton", die aus der menschlichen Kultur nicht wegzudenken ist. Die Verwendung von Ton ist vielfältig und hat eine Tradition von Jahrtausenden vorzuweisen. Die Töpferei-Arbeit ist sicherlich fast so alt wie die Menschheit selbst und eine der ersten kulturellen Tätigkeiten, neben der Herstellung von Waffen, Werkzeugen sowie Flechtwaren und Weberei-Erzeugnissen für Alltagsgegenstände, Bekleidung und andere Textilien.
Feldspat in Metamorphit
In einer "Tertiären Bildung" entstehen sogenannte Metamorphite, wie beispielsweise Gneis, der Feldspat als Bestandteil aufweist. Unter hohen Temperaturen und enormen Druck wandeln sich dabei bereits bestehende magmatische oder sedimentäre Gesteine um, ohne sich erneut zu verflüssigen. Typische Ausgangsgesteine für diese sogenannte "Metamorphose" (Umwandlung) sind Basalt, Schiefer und Granit.
Metamorpher Gneis zeigt eine parallele Textur und besteht, neben Quarz und Glimmer, aus über 20% Feldspat.
Das monokline und trikline Kristallsystem
Wie sich zeigt, ist der häufig vorkommende Feldspat nicht gleich Feldspat. Auch wenn sie in die gleiche Gesteinsgruppe gehören, kristallisieren die einzelnen Feldspate unterschiedlich aus, was den jeweiligen Entstehungsbedingungen an ihren Fundorten geschuldet ist. Je nach dieser Kristallisation unterscheidet man zwei Typen.


 Schmuckstücke
Schmuckstücke
 Natürliche Steine
Natürliche Steine
 Bücher & DVD
Bücher & DVD